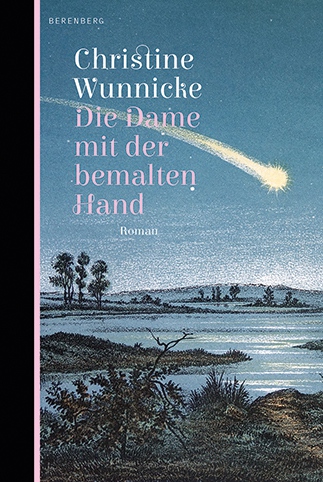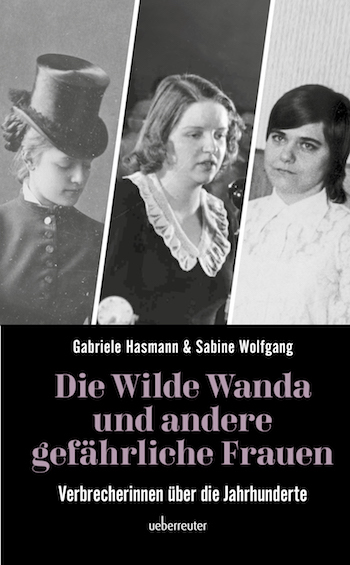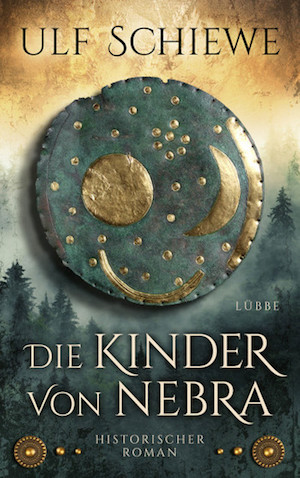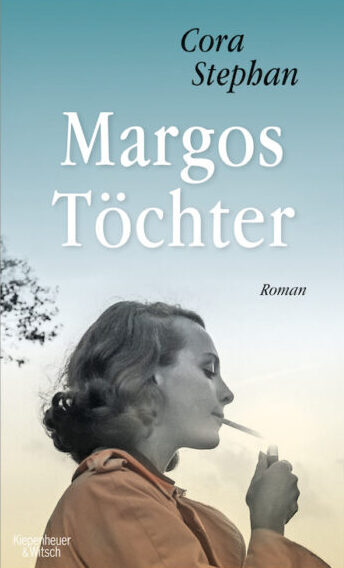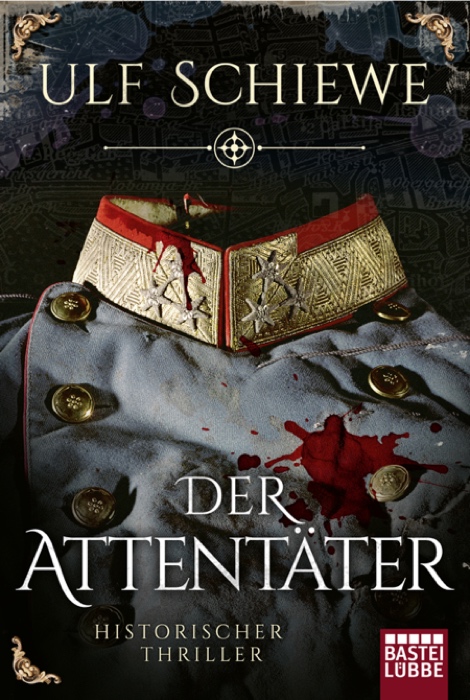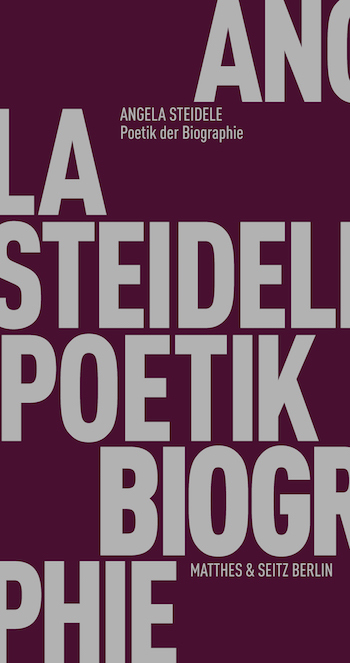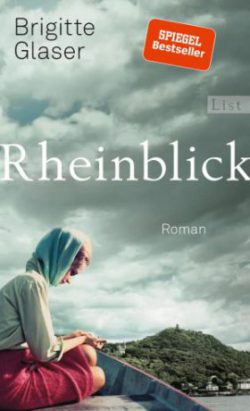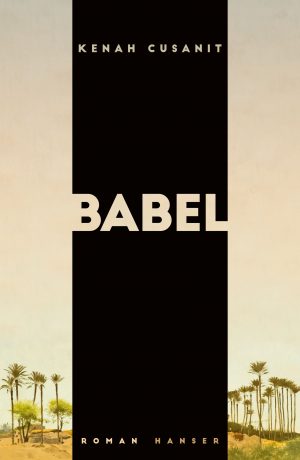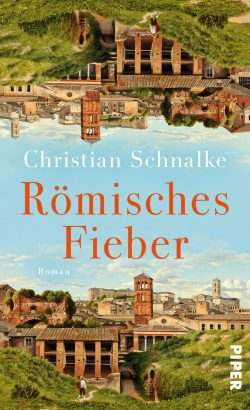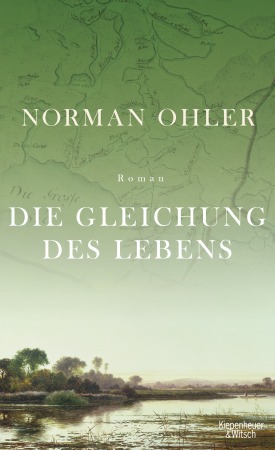Christine Wunnicke – Die Dame mit der bemalten Hand
Christine Wunnicke – »Die Dame mit der bemalten Hand« – Um es gleich vorweg zu sagen: Viele Damen kommen in diesem Roman nicht vor, der Titel bezieht sich auf ein Sternbild aus der arabischen Astronomie, eine echte Dame mit Henna bemalter Hand erscheint in der Schlussszene und zwar die Tochter der Hauptfigur Musa al-Lahuri. Ansonsten ist es die Geschichte der Begegnung zweier Männer: Auf seiner Rückreise von einem Kunden, für den er ein teures Astrolabium gefertigt hat, strandet Musa 1764 auf einer verwilderten Insel irgendwo vor Indien. Dort trifft er auf den deutschen Forschungsreisenden Carsten Niebuhr, der dort, erkrankt und dem Wahnsinn nahe, in einem verfallenen Hindu-Tempel haust. Musa päppelt ihn auf, mehr aus Verpflichtung denn mit echter Begeisterung und man kommt ins Gespräch. In viele Gespräche. In Rückblenden erfährt die Leserschaft vom Schicksal der Forschungsexpedition, die in den Diensten des dänischen Königs aufbrach, um den wissenschaftlichen Gehalt der Bibel im vorderen Orient zu erforschen. Sobald der Deutsche seine gute Stube verlässt, ist er offensichtlich dem Tod und/ oder dem Wahnsinn geweiht: Von sechs Expeditionsteilnehmern …