Histo Journal Buchbesprechung: Linus Reichlin »Manitoba«
Gelesen & Notiert von Ilka Stitz
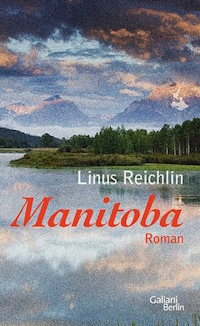
Inhalt
Manitoba
Inhalt
Er war noch ein kleiner Junge, als seine Mutter ihm das Familiengeheimnis anvertraute: dass sein Urgroßvater ein Indianer gewesen sei, in den sich die Urgroßmutter, die einst in Amerika als Lehrerin in der Missionsschule gearbeitet hatte, verliebte. Allerdings wurde er kurze Zeit später ermordet und die Urgroßmutter kehrte in die Schweiz zurück.
Es fiel gerade Schnee, als die Mutter über die Vorfahren sprach; Amerika und die Welt der Indianer waren sehr weit weg, die ganze Sache klang wie ein fremdes, exotisches Märchen.
Doch viele Jahre später – aus dem Jungen ist inzwischen ein mäßig erfolgreicher Schriftsteller geworden – begibt er sich auf die Spur seiner Ahnen. Die Tagebuchaufzeichnungen seiner Urgroßmutter sollen ihm wie der Faden der Ariadne dazu verhelfen, seine indianischen Wurzeln zu finden. Doch erweisen sich die Aufzeichnungen als ungenau, ja scheinen oft nicht zu stimmen. Die Geschichte seiner Abstammung wird immer löchriger, je tiefer er sich in sie hineinbegibt und das Schicksal der Arapaho und der anderen Indianerstämme kennenlernt, die in Reservate gedrängt wurden, weil Siedler aus Europa kamen, sich Land nahmen und es angeblich zivilisierten. Die Geringschätzung der hochentwickelten Indianerkultur ärgert ihn immer stärker, je mehr er sich sehnsüchtig mit ihr identifiziert.
Als er in einer einsam gelegenen Hütte in den Wäldern von Manitoba versucht, für eine Weile wie seine indianischen Vorfahren zu leben, muss er jedoch erfahren, dass auch er als unwillkommener Eindringling angesehen wird.
Hardcover mit SU
288 Seiten
ISBN 978-3-86971-131-7
Auch als eBook erhältlich
Preis: 19,99 Euro
Eine Leseprobe finden Sie auf der Website des Galiani-Berlin Verlages.
Ein Roman über Geschichte, ihre Bedeutung im Großen wie im Kleinen, über die Vergangenheit und die Erinnerung an vergangenes, im engen und im weiten, ja weitesten Sinne.
Manitoba ist kein historischer Roman. Und doch passt er gut in das Konzept unseres Journals. Denn Manitoba ist ein Roman über Geschichte, ihre Bedeutung im Großen wie im Kleinen, über die Vergangenheit und die Erinnerung an vergangenes, im im engen und im weiten, ja weitesten Sinne. Damit wird »Manitoba« zu einem Roman über Identität, über ihr Wesen und ihre Bedeutung.
Am Anfang des Romans steht die Familiengeschichte des Schriftstellers Max Beer: »Es ist eigentlich merkwürdig, dass ich erst jetzt nach Fort Washakie fuhr und nicht schon vor dreißig Jahren. Ich war mit dem Namen dieses Ortes aufgewachsen. … An einem Winterabend, an dem vor dem Fenster meines Zimmers große Flocken fielen und es im ganzen Haus sonderbar still war, saß sie an meinem Bett und erzählte mir mit leiser Stimme von ihrem Großvater, der ein Indianer gewesen sei …« {Seite 5} So beginnt der Roman von Linus Reichlin. Der Ich-Erzähler Max Beer stammt aus der Schweiz, und lebt inzwischen in Berlin {hier weist der Roman durchaus autobiographische Züge auf}. Der Schriftsteller sucht nach einer Geschichte für seinen nächsten Roman und erhofft sich die zündende Idee durch seine indianischen Wurzeln. Er beschließt, das private Interesse an seiner Familiengeschichte mit der Recherche für ein neues Buch zu verbinden. Also bucht er eine Reise nach Amerika, um in den Indianerreservaten nach seinen Wurzeln zu forschen. Außerdem mietet er sich eine Blockhütte in Kanada. Denn nur dort, in der Wildnis Manitobas nahe dem Lac Brochet, kann man noch das ursprüngliche, einfache Leben fern aller Zivilisation kennenlernen.
Die Grundlage seiner Recherche bilden die Tagebücher seiner Urgroßmutter, in denen sie ihre Auswanderung nach Amerika schildert, ihr Leben an der St. Stephen’s Indian Mission in Fort Washakie, in der sie als Lehrerin die Kinder der Arapaho-Indianer unterrichtete. Und die Liebesgeschichte zu Nisono’oho, dem stolzen Indianer.
Damit ist die Route festgelegt und es beginnt die Suche des Max Beer. Sie entpuppt sich zu einer Suche nach Geschichte. Schnell wird klar, ›die‹ Geschichte gibt es nicht. Es handelt sich stets um Geschichte, die aus der eigenen Erinnerung erwächst und deren Beziehung zu derjenigen, die aus den Erinnerungen anderer entsteht. Daher gibt es viele Facetten von Geschichte, sie können wahr oder falsch sein. Geschichte ergibt sich nicht nur aus der Aneinanderreihung von Geschehnissen, sie ist ebenso Tradition, Kultur, die ein Volk, ein Land, eine Gemeinschaft, eine Familie verbinden und prägen.
Gleichermaßen geht es in »Manitoba« aber auch um die Kehrseite der Medaille, nämlilch darum, wie sich die Abwesenheit von Geschichte, im Sinne von Tradition und Kultur, aber auch persönlichem Erleben, beziehungsweise eben Nicht-Erleben auswirken. Was bedeuten also Geschichte und Kultur für ein Volk, und damit für den einzelnen Menschen? In seinem Roman geht es Linus Reichlin also um ganz essentielle Grundlagen jeder Gesellschaft, um Zivilisation, um das kulturstiftende der Tradition, dieser gemeinsam erlebten und bewältigten Vergangenheit und um dessen Bewahren. Ja, vor allem um das Bewahren, das die Vergangenheit erst mit Wahrhaftigkeit erfüllt. Gänzlich unabhängig von Wahrheit oder Unwahrheit.
Das klingt kompliziert. Aber weil es eigentlich eine einfache Familiengeschichte ist, aber vor allem wegen der wunderbar schlichten und doch bildhaften Sprache, wegen des leisen Humors, der Selbstironie, gelingt es Linus Reichlin dieses komplexe Thema auf eine Ebene zu heben, dass der Leser seiner Geschichte mit Genuss folgt.
Das Leben des Max Beer, eines Schriftstellers, ist geprägt durch eine Kontinuität des persönlichen Scheiterns. So scheint es. Seine Ehe ist geschieden, er ist mittelmäßig erfolgreich, das Debut seines Sohnes indes, ebenfalls Schriftsteller, wird sofort zum Bestseller und mit Preisen überschüttet. Der Erfolg des Sohnes – das würde er nie zugeben – erfüllt ihn mit Neid. Seine Ex-Frau verachtet ihn. Ihre Beziehung beschränkt sich hauptsächlich auf Schuldzuweisungen. Ebenso unterkühlt ist die Beziehung zu seinem Sohn.
Aber nun will Max Beer es allen beweisen. Einerlei, dass sein neues Romanprojekt von Exfrau und Sohn belächelt wird. Seine Indianergeschichte, vertane Zeit, urteilt Sohn Jonas. Fast trotzig macht sich Max Beer an die Aufgabe, der Geschichte seiner Urgroßmutter auf den Grund zu gehen. Alles scheint einfach, die Schilderungen seiner Vorfahrin sind eindeutig, die Recherche weniger eine Erforschung als eine ›Inaugenscheinnahme‹. Das einzig Unkalkulierbare an seiner Reise scheint die Zeit in der Wildnis Kanadas, die Beer ein wenig beunruhigt.
Was war seine Ahnin eigentlich für eine Frau? Der Leser lernt sie durch ihre Tagebuchaufzeichnungen kennen. Maria Reichmuth muss ganz besonders gewesen sein. Damals war es schließlich nicht selbstverständlich, als Frau die Heimat zu verlassen. Sie war jung verwitwet, als ihr ein ausgewanderter Verwandter die Stelle in Wyoming empfiehlt. Und tatsächlich macht sie sich auf, in das unbekannte Land. Sorgfältig notiert sie, was ihr widerfuhr, beschreibt ihre Arbeit, die Menschen vor Ort, und nicht zuletzt ihre Begegnung mit dem Indianer Nisono’oho, den die Weißen John Nose nennen. In den sie sich verliebt, und von dem sie schließlich ein Kind erwartet. Doch {nicht nur} zu dieser Zeit, wir alle wissen das, hatten es Indianer schwer in diesem Land. Wegen einer Nichtigkeit wird Nisono’oho ermordet, die Urgroßmutter kehrt schwanger in die Schweiz zurück. »In ihrer Heimat Steinen würde man zwar über ihre Rückkehr als schwangere Frau ohne Mann nicht jubeln, auch in Steinen würde es das Kind schwer haben, aber man würde ihm nicht ins Gesicht spucken, nur weil sein Vater ein Indianer war, denn die Menschen aus Steinen kannten Indianer nur aus Büchern, und darin gab es auch edle und anständige Indianer, und waren nicht die Morschacher in den Kindheitstagen meiner Urgroßmutter durchaus stolz auf ihren Japaner gewesen, der aus irgendeinem Grund in ihrem Dorf gestrandet war und dort bis zu seinem Tod unter dem Namen Japanesen-Sepp gelebt hatte?« {S. 167}
Urgroßmutter Marias Schilderungen der Ereignisse sind voller Details, obwohl sie die Tagebücher erst im hohen Alter aus dem Gedächtnis verfasst hat, was Max Beer die kleinen Widersprüchlichkeiten in ihrer Darstellung erklärt. Klar genug jedenfalls, um sicher zu sein, das Beschriebene vor Ort wiederzufinden. Es sollte also ein Leichtes sein, ihren Spuren in Wioming, wie sie es in ihren Tagebüchern schreibt, zu folgen. Doch es ist nicht so einfach wie gedacht. »Das ist die ganze Geschichte, wie meine Urgroßmutter sie in ihrem Tagebuch beschreiben hat. Jedenfalls dachte ich, dass es so gewesen ist. Es gab keinen Grund, daran zu zweifeln. Bis ich Hebesisei Willow traf -« {S. 168}
Im Laufe seiner Reise muss Max Beer etwas lernen, das er bislang gern verdrängte: Zu der Suche nach den eigenen Vorfahren, also der eigenen Familiengeschichte, gehört immer die Reflexion der ganzen, damit also auch der jüngsten Familiengeschichte. Und die ist nicht unbedingt so, wie man sie sich vorstellt. Wie zum Beispiel die Beziehung zu seiner Frau, und zu seinem Sohn. Es ist ja eher eine Nicht-Beziehung, eine Fremdheit, die zwischen Menschen herrscht, die eigentlich durch familiäre Bande eng verknüpft sein sollten. Tatsächlich sind es sogar eher Nicht-Beziehungen, die das Familienleben des Ich-Erzählers prägen. Es herrscht eine Atmosphäre des Unausgesprochenen, der Sprachlosigkeit. Linus Reichlin lässt sie in einer der SMS fühlbar werden, die Beer seinem Sohn schickt. Er sendet sie ihm zur Versöhnung, nachdem er ihm zuvor am Telefon seine Teilnahme an dessen Preisverleihung abgesagt hat, weil er zu dem Zeitpunkt noch in Manitoba sei. Er beginnt wortreich, schreibt Entschuldigungen, gibt Erklärungen, löscht immer mehr davon, und am Ende bleibt: »Lieber Jonas, schlaf gut.« {S. 72}
Dagegen wirkt Beers Verhältnis zu Fremden, denen er auf seiner Reise begegnet, wie dem Hotelmanager Ned Cloud, einem Indianer, geradezu familiär. Beruht diese Nähe tatsächlich auf den gemeinsamen indianischen Vorfahren, einer gemeinsamen kollektiven Erinnerung, der gemeinsamen Geschichte? Oder reicht allein der Glaube, dass es diese Gemeinsamkeit gibt, schon aus? Letztlich zeigt sich, wie trügerisch Erinnerungen sein können, wie zerbrechlich das scheinbar festgefügte, so sicher geglaubte Fundament der Geschichte mitunter ist.
Fazit
Ein großartiges Buch, das mit leichter Hand, facettenreich in Sprache und Erzählebenen ein gewichtiges Thema behandelt. Die Bedeutung von Geschichte, von Kultur, von Identität. Deren Bedeutung man vielleicht erst durch ihre Abwesenheit ermessen kann. Diese Trostlosigkeit der Leere, der schmerzende Verlust, bis hin zum Verlust der eigenen Identität, wenn man es zulässt.
Der Autor

Linus Reichlin, geboren 1957, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Für seinen in mehrere Sprachen übersetzten Debütroman »Die Sehnsucht der Atome« erhielt er den Deutschen Krimi-Preis 2009. Sein Roman »Der Assistent der Sterne« wurde zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2010 {Kategorie Unterhaltung} gewählt. Über seinen Eifersuchtsroman »Er« schrieb der Stern: »Spannend bis zur letzten Minute«. 2014 erschien »Das Leuchten in der Ferne«, ein Roman über einen Kriegsreporter in Afghanistan. 2015 folgte der Roman »In einem anderen Leben«, 2016 »Manitoba«.
