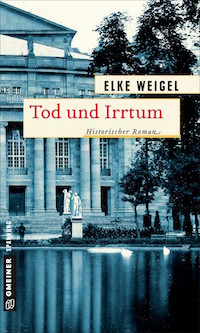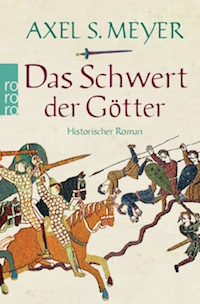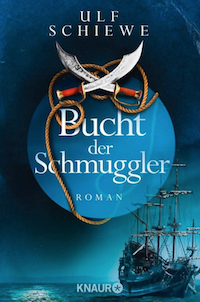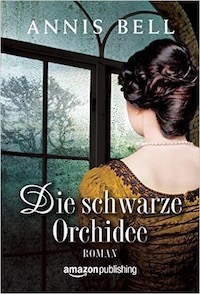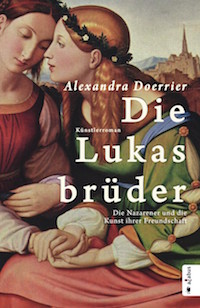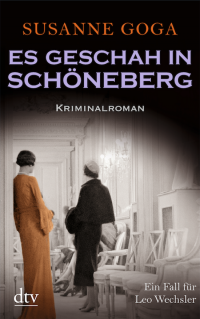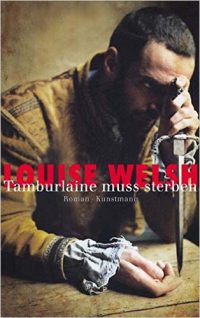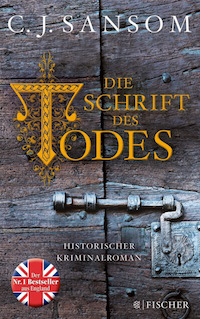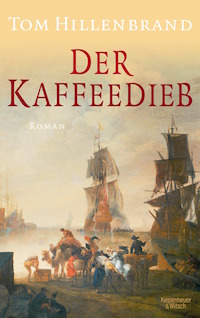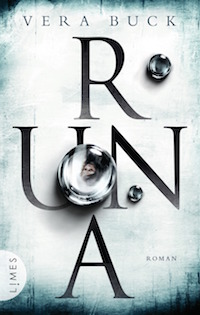Tod und Irrtum
Elke Weigel: »Tod und Irrtum« – »Sie wären erfreut zu sehen, wie zuversichtlich und voller guter Vorsätze ich meiner Zukunft entgegen gehe.« – Zur Erinnerung: Die Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren von einem selbstbestimmten Leben qua Geburt Lichtjahre entfernt {zumindest die meisten von ihnen}. Ihre Rolle war klar umrissen. Die gehorsame Tochter heiratete den Mann, den die Eltern für sie ausgesucht hatten. Was folgte, war ein vorgezeichnetes Leben als {gehorsame} treue Ehefrau und aufopferungsvolle, liebevolle Mutter. Die Verwirklichung der eigenen Träume {Abitur, Studium, Beruf} stand bei den meisten Frauen nicht zur Diskussion. Mehr als verständlich, dass Frauen wie Emmeline Pankhurst {Suffragetten} die Gleichberechtigung für Frauen einforderten, deutsche Frauenrechtlerinnen endlich das Wahlrecht auch für Frauen verlangten {worüber sie sich dann aber erst Ende November 1918 freuen durften, die Engländerinnen mussten ganze zehn Jahre länger darauf warten}. Stuttgart 1910: Endlich zurück in der Heimatstadt. Henriette Haag, monatelang auf Reisen unterwegs, kann es gar nicht abwarten endlich den Fuß über die Schwelle ›ihres‹ Hauses zu setzen {in der Wahl des Pronomens ist die jetzige Witwe noch …